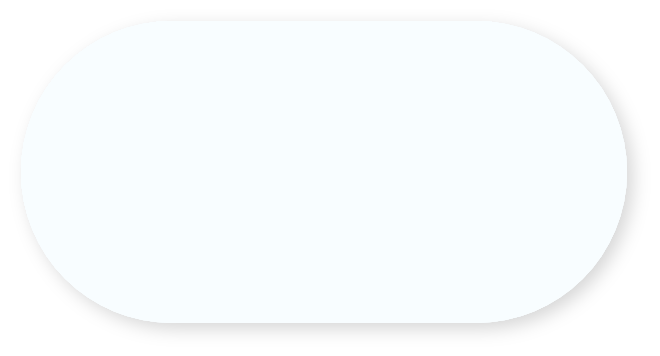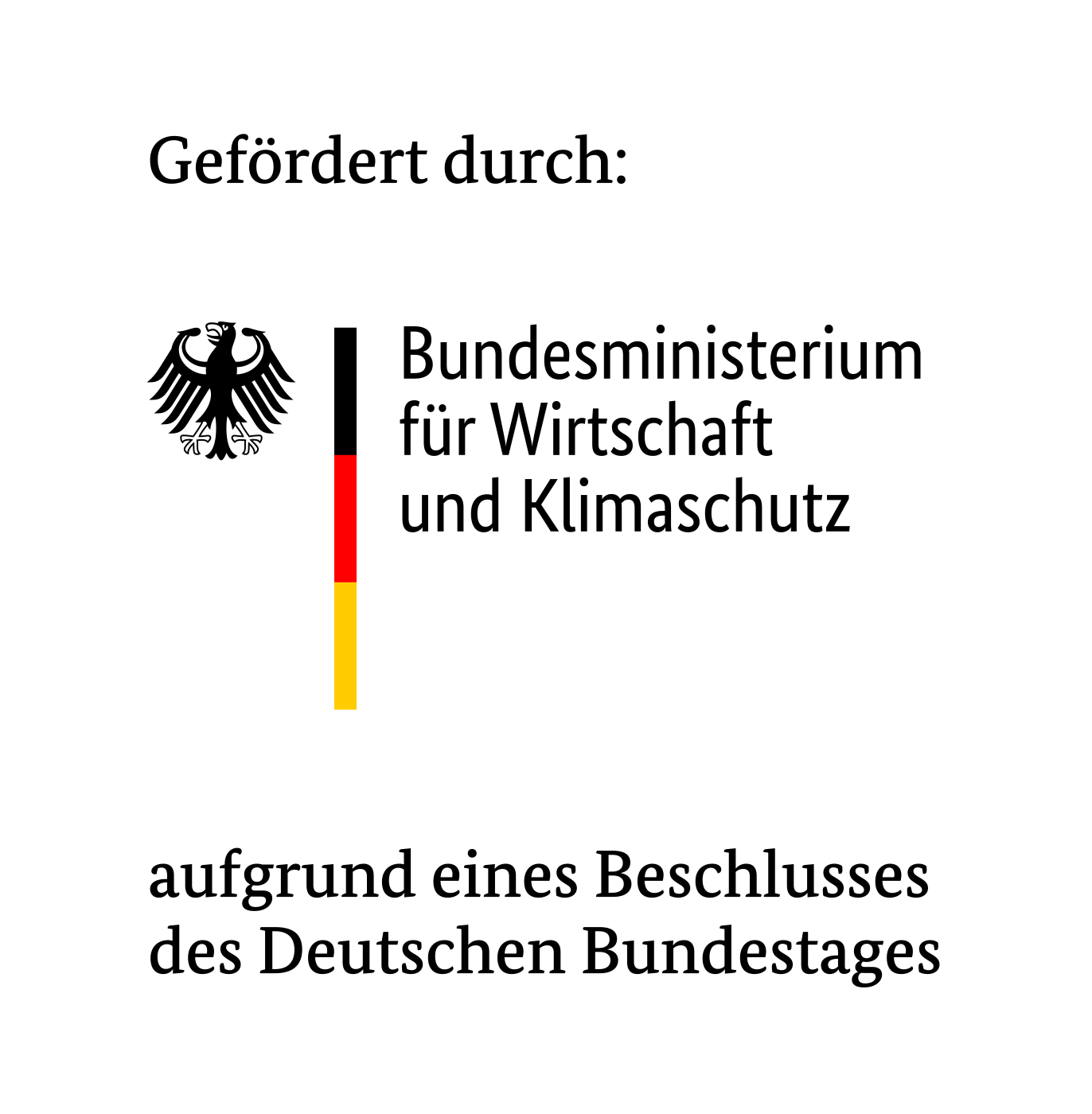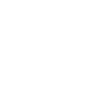Kältetechnik
Einführung
Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen, Funktionsweisen, Einsatzbereiche in Handwerksbetrieben und Effizienzpotenziale von Kälteanlagen beschrieben. Ferner wird nur das Thema Prozesskälte betrachtet, die Gebäudekühlung/ Klimatisierung wird hier nicht betrachtet. In Deutschland werden 14% des Stromverbrauches und 6% des Primärenergieverbrauches für die Kälteerzeugung benötigt. 67% davon entfallen auf die Nahrungsmittelindustrie.
Tangierende Querschnittstechnologien:
Heizung/Klima/Lüftung
Kraft-Wärme-Kopplung
Abwärmenutzung
Einsatzbereiche von Prozesskälte
Fleischereien, Bäckereien, Konditoreien sowie Hersteller von Speiseeis benötigen Prozesskälte. Ebenso wird in der Gastronomie, im Einzel- und Großhandel für das Kühlen von Waren in Lagerhäusern sowie zur Lagerung von Halb-und Fertigprodukten in Kühlräumen oder Gefrierräumen/Truhen, Kälte eingesetzt.
Innerhalb von Produktionsprozessen spielt Kältetechnik ebenfalls eine wichtige Rolle (z.B. bei der Wurstherstellung in Fleischereien wird dem Kutter zum Abkühlen des Wurstbräts Eis oder Eiswasser in die Masse zugegeben.
Physikalische / chemische Grundlagen
Physikalisch betrachtet, ist Kälte zunächst ein Temperaturunterschied. Sie ist ein Energieniveau, das unter dem seiner Umgebung liegt. Um zu kühlen, muss Wärme entzogen werden, die an anderer Stelle wieder abgegeben wird. Dieser thermodynamische Kreisprozess findet in der Kältemaschine statt. Für diesen Prozess wird elektrische oder thermische Energie aufgewendet. Die beiden Hauptverfahren der Kältetechnik sind der Kompressionskälteprozess und der Absorptionskälteprozess. Überwiegend werden Kompressionskälteanlagen (mechanische) eingesetzt, deren Verdichter (Kompressor) meist mit Strom angetrieben wird. Absorptionskälteanlagen dagegen erzeugen mittels thermischer Energie Kälte.
Kompressionskälteanlagen (marktbeherrschend und vielfältig)
In handelsüblichen Kompressionskältemaschinen (KKM) wird durch den Einsatz von elektrischem Strom ein flüssiges Kühlmittel, das sich in einem Kreisprozess befindet, erst verdampft, anschließend verdichtet, dann verflüssigt und am Ende wieder entspannt. Hierbei wird vom Kühlmittel die unerwünschte Wärme auf der einen Seite aufgenommen (Kühlzelle), um sie auf der anderen Seite wieder abzugeben - der Entzug von Wärme wird somit durch Verdampfen einer Flüssigkeit (Kältemittel) erreicht. Dazu werden spezielle Kältemittel eingesetzt, die schon bei tiefer Temperatur und niedrigem Druckniveau verdampfen. Nach der Verdampfung wird das Kältemittel durch einen Kompressor verdichtet und bei höherem Druck und höherer Temperatur kondensiert (verflüssigt). Bei der Verflüssigung wird die Verdampfungswärme wieder freigesetzt und muss über den Kondensator an die Umgebung abgegeben werden. Je geringer die Temperaturdifferenz (ΔT) zwischen der kalten Seite (Verdampfer) und der warmen Seite (Verflüssiger) ist, umso besser die Leistungszahl der Anlage und damit deren Energieeffizienz.
Tangierende Querschnittstechnologien:
Heizung/Klima/Lüftung
Kraft-Wärme-Kopplung
Abwärmenutzung
Einsatzbereiche von Prozesskälte
Fleischereien, Bäckereien, Konditoreien sowie Hersteller von Speiseeis benötigen Prozesskälte. Ebenso wird in der Gastronomie, im Einzel- und Großhandel für das Kühlen von Waren in Lagerhäusern sowie zur Lagerung von Halb-und Fertigprodukten in Kühlräumen oder Gefrierräumen/Truhen, Kälte eingesetzt.
Innerhalb von Produktionsprozessen spielt Kältetechnik ebenfalls eine wichtige Rolle (z.B. bei der Wurstherstellung in Fleischereien wird dem Kutter zum Abkühlen des Wurstbräts Eis oder Eiswasser in die Masse zugegeben.
Physikalische / chemische Grundlagen
Physikalisch betrachtet, ist Kälte zunächst ein Temperaturunterschied. Sie ist ein Energieniveau, das unter dem seiner Umgebung liegt. Um zu kühlen, muss Wärme entzogen werden, die an anderer Stelle wieder abgegeben wird. Dieser thermodynamische Kreisprozess findet in der Kältemaschine statt. Für diesen Prozess wird elektrische oder thermische Energie aufgewendet. Die beiden Hauptverfahren der Kältetechnik sind der Kompressionskälteprozess und der Absorptionskälteprozess. Überwiegend werden Kompressionskälteanlagen (mechanische) eingesetzt, deren Verdichter (Kompressor) meist mit Strom angetrieben wird. Absorptionskälteanlagen dagegen erzeugen mittels thermischer Energie Kälte.
Kompressionskälteanlagen (marktbeherrschend und vielfältig)
In handelsüblichen Kompressionskältemaschinen (KKM) wird durch den Einsatz von elektrischem Strom ein flüssiges Kühlmittel, das sich in einem Kreisprozess befindet, erst verdampft, anschließend verdichtet, dann verflüssigt und am Ende wieder entspannt. Hierbei wird vom Kühlmittel die unerwünschte Wärme auf der einen Seite aufgenommen (Kühlzelle), um sie auf der anderen Seite wieder abzugeben - der Entzug von Wärme wird somit durch Verdampfen einer Flüssigkeit (Kältemittel) erreicht. Dazu werden spezielle Kältemittel eingesetzt, die schon bei tiefer Temperatur und niedrigem Druckniveau verdampfen. Nach der Verdampfung wird das Kältemittel durch einen Kompressor verdichtet und bei höherem Druck und höherer Temperatur kondensiert (verflüssigt). Bei der Verflüssigung wird die Verdampfungswärme wieder freigesetzt und muss über den Kondensator an die Umgebung abgegeben werden. Je geringer die Temperaturdifferenz (ΔT) zwischen der kalten Seite (Verdampfer) und der warmen Seite (Verflüssiger) ist, umso besser die Leistungszahl der Anlage und damit deren Energieeffizienz.
Technologien der Kompressionskälte
- Verdrängungsprinzip: Hubkolben oder Drehkolben (Drehspirale oder Schraubenrotor)
- Strömungsprinzip: Turbolaufrad - radial oder axial
- breiter Leistungsbereich
- von Wärmepumpe bis Tieftemperaturkälte

|
| Kompressionskälte |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |
Absorptionskältemaschine
In der Regel kommen in Handwerksbetrieben zur Kälteerzeugung Kompressionskälteanlagen zum Einsatz. Alternativ kann die Nutzung von Absorptionskältetechnik energetisch sinnvoll und wirtschaftlich sein, wenn ausreichend thermische Energie aus Abwärme/Produktionsprozessen, Solarkollektoren oder einem BHKW zur Verfügung steht und der benötigte Kältebedarf nicht zu tief ist. Hierbei muss man zwischen zwei Kältemitteln/ Arbeitsstoffen unterscheiden. Da wäre zum einen Ammoniak (Kältemittel) – Wasser (Lösungsmittel) zu nennen, bei denen Kühltemperaturen von bis zu minus 60°C möglich sind. Zum zweiten gibt es Wasser (Kältemittel) und Lithiumbromid (Lösungsmittel) bei dem Kühltemperaturen nur bis zu plus 4,5°C möglich sind.
Vorteile der Nutzung von Absorptionskälte:
In der Regel kommen in Handwerksbetrieben zur Kälteerzeugung Kompressionskälteanlagen zum Einsatz. Alternativ kann die Nutzung von Absorptionskältetechnik energetisch sinnvoll und wirtschaftlich sein, wenn ausreichend thermische Energie aus Abwärme/Produktionsprozessen, Solarkollektoren oder einem BHKW zur Verfügung steht und der benötigte Kältebedarf nicht zu tief ist. Hierbei muss man zwischen zwei Kältemitteln/ Arbeitsstoffen unterscheiden. Da wäre zum einen Ammoniak (Kältemittel) – Wasser (Lösungsmittel) zu nennen, bei denen Kühltemperaturen von bis zu minus 60°C möglich sind. Zum zweiten gibt es Wasser (Kältemittel) und Lithiumbromid (Lösungsmittel) bei dem Kühltemperaturen nur bis zu plus 4,5°C möglich sind.
Vorteile der Nutzung von Absorptionskälte:
- Einsatz umweltfreundlicher Kältemittel wie Wasser möglich,
- längere Lebensdauer – wenig bewegliche Teile, niedrigere Betriebskosten (Einsparung elektrischer Energie), dafür aber höhere Investitionskosten
- relativ geringes Temperaturniveau (ca. 85°C bis 160°C) nötig, hierfür kann z.B. die Abwärme eines BHKW genutzt werden, des Weiteren wird dadurch die Laufzeit des BHKW verlängert (Stichwort: Kräft-Wärme-Kälte-Kopplung)

|
| Kältebedarf |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |
Verfahren zur Kälteerzeugung
Kompressionskältemaschine
- verbreiteteste Technologie
- elektrischer Antrieb
- Kältemitte: FCKW, Wasser, CO2, NH3

|
| Verfahren zur Kälteerzeugung |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |
Thermische Kältemaschinen
- Abwärmenutzung / Wärme aus Sonne, KWK
- umweltfreundliche Kältemittel (z.B. Wasser)
- lange Lebensdauer (keine beweglichen Teile)
- niedrige Betriebs-, aber höhere Invetitionskosten

|
| Verfahren zur Kälteerzeugung |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |
Kältemittel
Welches Kältemittel im Prozess verwendet wird, hängt von der gewünschten Kühltemperatur und den unterschiedlichen Einsatzerfordernissen ab.
Weitere Kriterien sollten das Ozonabbaupotenzial, der Grad der Treibhausschädigung sowie der Energieverbrauch sein. Der Austausch des Kältemittels ist jedoch meist eine komplexe Aufgabe und sollte daher immer einem Fachmann überlassen werden.
Natürliche Kältemittel:
(überwiegend eingesetzt bei Absorptionskälteanlagen)
Kältemittel werden entsprechend ihrer Brennbarkeit und Giftigkeit eingeordnet und in verschiedene Sicherheitsgruppen eingeteilt. (EN 378-1 Anh. E):
A1, A2, A3, B1, B2, B3.
Welches Kältemittel im Prozess verwendet wird, hängt von der gewünschten Kühltemperatur und den unterschiedlichen Einsatzerfordernissen ab.
Weitere Kriterien sollten das Ozonabbaupotenzial, der Grad der Treibhausschädigung sowie der Energieverbrauch sein. Der Austausch des Kältemittels ist jedoch meist eine komplexe Aufgabe und sollte daher immer einem Fachmann überlassen werden.
Natürliche Kältemittel:
(überwiegend eingesetzt bei Absorptionskälteanlagen)
- Ammoniak (NH3),
- Lithiumbromid (LiBr)
- Wasser
- Kohlendioxid (CO²)
- Kohlenwasserstoffe (z.B. Propan, Butan)
- Halogenierte Kohlenwasserstoffe: FKW, HFCKW und FCKW (seit 1990 in der Bundesrepublik Deutschland verboten)
- thermisches und thermodynamisches Verhalten
- die kritische Temperatur und der kritische Druck des Kältemittels sollten immer über dem „kritischen Zustand“ der Kältemaschine liegen
- der „kritische Zustand“ ist der Punkt, ab dem keine Phasentrennung des Kältemittels zwischen flüssig und gasförmig stattfindet (Verdampfung und Kondensation sind nicht mehr gegeben)
- chemisches Verhalten bzgl. Mischungsfähigkeit, Fließfähigkeit, Schmierfähigkeit, aber auch Sicherheitsaspekte
(Druckbelastung / Brennbarkeit) - physiologische Eigenschaften (Gesundheitsgefahren z.B. bei Neubefüllungen, Wartung und Recycling oder bei Leckagen)
- ökologische Anforderungen (Treibhauseffekt, Ozonabbaupotenzial)
Kältemittel werden entsprechend ihrer Brennbarkeit und Giftigkeit eingeordnet und in verschiedene Sicherheitsgruppen eingeteilt. (EN 378-1 Anh. E):
A1, A2, A3, B1, B2, B3.

|
| Einteilung Kältemittel |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |
Normen und Kennzeichnungen
Überblick über die wichtigsten Rechtsnormen und Veränderungen:
Überblick über die wichtigsten Rechtsnormen und Veränderungen:
- seit dem 01.01.2015 gilt die Revision der F-Gas-Verordnung (EG) Nr. 842/2006 – neue F-Gas-Verordnung (EU) Nr. 517/2014
- Verordnung der EG Nr. 1005/2009 (Stichwort R22)
- seit dem 01.01.2015 dürfen Kälteanlagen mit R22 Kältemittel weiterhin betrieben werden, aber ein Nachfüllen mit Kältemittel R22 (auch nicht aufbereitete Recyclingware) ist generell verboten
- ergänzend und konkretisierend dazu: Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV):
- der Betreiber der Anlage ist dafür verantwortlich, dass nicht allein die beauftragte Firma, sondern auch das ausführende Personal (ggf. auch Nachunternehmer) zertifiziert ist (Artikel 10 F-Gas-Verordnung, Sachkundebescheinigung). Die persönlichen Anforderungen sind in der ChemKlimaschutzV näher spezifiziert
- bei der Berechnung, wie schädlich ein Kältemittel für das Klima ist, ist nicht mehr entscheidend wie viele kg Kältemittel sich in der Anlage befinden, sondern dessen Tonnen CO2-Äquivalent (Füllmenge multipliziert mit dem GWP)
- das „GWP“ (global warming potential) oder auch als „Treibhauspotential“ bezeichnet, bezeichnet das Klimaerwärmungspotential eines Treibhausgases (Kältemittel) im Verhältnis zum Kohlendioxid
- z.B. 1 kg R134a hat ein CO2-Äq. von 1.430 kg
1 kg R404a hat ein CO2-Äq. von 3.922 kg
- z.B. 1 kg R134a hat ein CO2-Äq. von 1.430 kg
- das Intervall der Dichtheitsprüfungen richtet sich nach CO2-Äquivalent (Artikel 4 F-Gas-Verordnung) siehe auch:
www.umweltbundesamt.de

|
| GWP verschiedener Kältemittel |
| Copyright: UZH des Handwerks Thüringen |
Das Kältemittel R22 kann durch folgende Kältemittel ersetzt werden:
R404A, R507, R407C, R410A, R290 (Propan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2)
Zeitplan: Verbote des Inverkehrbringens (Artikel 11 Abs. 1 Anhang III der F-Gas-Verordnung)
R404A, R507, R407C, R410A, R290 (Propan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2)
Zeitplan: Verbote des Inverkehrbringens (Artikel 11 Abs. 1 Anhang III der F-Gas-Verordnung)

|
| Verbote Kühlgeräte |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |

|
| Dichtheit von Kälteanlagen |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |
Übergangsregelung (Artikel 4): Bis 31.12.2016 sind Einrichtungen mit < 3 kg Füllmenge oder bei hermetisch geschlossenen Einrichtungen < 6 kg CO2-Äq. keine Dichtheitskontrollen notwendig.
Kältemittel-Kennzeichnung am Bsp. R22
Kältemittel-Kennzeichnung am Bsp. R22

|
| Kältemittelkennzeichnung |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |
Kühllager
Der Verdampfer mit Ventilatoren befindet sich wie in der obigen Abbildung meist an der Decke des Kühllagers und hat häufig eine rechteckige Bauform. Des Weiteren ist i.d.R. noch ein Temperaturfühler vorhanden. Energetisch relevant ist außerdem die Beleuchtung (evtl. bereits LED).
Typische energetische Schwachstellen im Kühllager
Typische energetische Schwachstellen im Kühllager
- Überhöhte Einlagerungstemperaturen (unterbrochene Kühlkette)
- zu tiefe Temperaturen im Kühllager (4% Energieeinsparung pro °C)
- Tor- und Türöffnungsintervalle zu lang und zu häufig:
Kalte Luft entweicht, feuchte und warme Luft strömt ein ⇒ Verdampfer vereist schneller ⇒ Kälteübertragung wird erheblich verschlechtert ⇒ häufigeres Abtauen ⇒ erhöhter Energieverbrauch. - zu lange Beleuchtungsdauern (keine Präsenzmelder) / zu hohe Lichtleistung:
Wärmeeintrag durch Lampen ⇒ mehr Stromverbrauch - durchgehender Ventilatorbetrieb (evtl. Anlagensteuerung prüfen)
- unzureichend gedämmte Türen und Tore, sowie der Umschließungsflächen
- undichte Tür- und Tordichtungen
- regelmäßige Abtauungen, z.B. mittels Zeitschaltuhr des Verdampfers: Meist wird elektronisch abgetaut ⇒ diese eingebrachte Wärme, muss vom Kältesystem wieder runtergekühlt werden
- Abtauung des Verdampfers nur nach Bedarf und Einstellung mit modernem Regler
- Umstellung von elektronischer Abtauung auf Kaltgas- oder Heißgasabtauung
- Zeitbedarfe für Abtauungen: elektronisch (30 min.), Kaltgas (10 min.), Heißgas (2 min.)
- Einsparungen bis zu 8% sind hierbei möglich
- Anpassung der Kälteregulierung durch Fachbetrieb
- Anpassung der Ventilatorsteuerung durch Fachbetrieb
- Einstellung des Expansionsventils (elektronisches) durch Fachbetrieb
- Anpassung der Kälteregulierung durch Fachbetrieb
- Anpassung der Ventilatorsteuerung durch Fachbetrieb
- Einstellung des Expansionsventils (elektronisches) durch Fachbetrieb
- Mögliche Kostenreduzierung durch Anpassung des Nutzerverhaltens
- Betriebssicherheit gewährleisten (regelmäßige Wartungen, Kontrolle von Anlagenkomponenten)
- Bei Teilbelegung von Kühlräumen: Verringerung des zu kühlenden Luftvolumens durch Einbringung von Styroporkartons
Vermeiden von zu langen Türöffnungszeiten: Regelmäßige Schulung der Mitarbeiter; Hinweisschilder / Betriebsanweisungen; elektronischer Türkontakt der nach einer gewissen Zeit Alarm schlägt (Hupe oder Blinklicht)

|
| Kühllager |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |

|
| Einsparungen im Kühllager |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |
Dichtungen an Türen und Schlössern
Kälteschutzvorhänge
Zugang zum Tiefkühlraum
- Einsparung durch verminderten Stromverbrauch
- Poröse oder beschädigte Dichtungen und Schlösser haben die gleichen Auswirkungen wie offene Kühlraumtüren
Türdichtungen können leicht in Eigenleistung gewechselt werden, wenn die Dichtungen nicht mehr direkt vom Hersteller angeboten werden, gibt es auch diese von anderen Firmen nachfertigen zu lassen.
Kälteschutzvorhänge
- Kälteschutzvorhänge dienen zur Verminderung der Lüftungswärmeverluste. Es gibt sie als Streifenvorhänge und bei größeren Anlagen in Form von Luftschleieranlagen.
- Streifenvorhänge gibt es ab ca. 400,- € und Luftschleieranlagen ab ca. 1.500,- €.
- Hygienevorschriften beachten!
- Einsparpotenzial mit optimal gedämmten Kühlräumen
| Richtwerte für Dämmungen | |
| Dämmstärke | Temperaturbereich |
| 80 mm | 0 - 8°C |
| 110 mm | 0 bis -15°C |
| 150 mm | unter Minus 15°C |
| PU Dämmstoff | |
Bei Neu-Planung oder Umbau: Der Zugang zum Tiefkühlraum sollte, wenn möglich, über den Kühlraum erfolgen. Die Kälte des Tiefkühlraums entweicht dann erst in den Kühlraum und wird dort noch ausgenutzt. Ein Eintrag von feucht-warmer Luft in den Tiefkühlraum wird dadurch vermieden (weniger Eisbildung).
Kühlmöbel
Aufstellort
Wie beim Verflüssiger, verringert sich auch bei den Kühlmöbeln (Kühl- und Gefrierschränke-oder Truhen, Getränkekühlschränken) der erforderliche Energiebedarf, je niedriger die Umgebungstemperatur ist. Beim Verflüssiger bewirkt eine um ein Grad geringere Umgebungstemperatur einen um 4% verminderten Energieverbrauch.
Folgende Aufstellorte sollten gemieden werden:
Auslastung und Bestückung
Bei nur teilweise bestückten Kühlmöbeln sollte geprüft werden, ob die Waren nicht in einem Kühlmöbel zusammengefasst werden können. Die dann nicht mehr benötigten Kühlmöbel können abgeschaltet werden. Achtung: Nicht über die Stapelmarke beladen, da es sonst zu einer Störung des Kühlluftschleiers kommt (Luftkanäle freihalten).
Beleuchtung
Wärme, die durch die Beleuchtung erzeugt wird, muss wieder von den Kühlaggregaten herunter gekühlt werden. Es sollten also Lampen mit einer geringeren Wärmeentwicklung (z.B. LED) eingesetzt werden, oder ihre Anzahl (Ausbau/Abschaltung) auf das erforderliche Maß reduziert werden, soweit es die
Tiefkühlware auftauen
Tief gefrorene Lebensmittel sollte man (wenn möglich) im Kühlmöbel auftauen, hierbei wirkt das Gefriergut als Kühlquelle und das Kühlmöbel verbraucht dadurch weniger Energie.
Abdeckung von Kühlmöbeln
In der Filiale aufgestellte offene Kühlmöbel laufen häufig 5-Tage pro Woche durchgängig. Sie verbrauchen also auch Energie und verschleißen dementsprechend, auch wenn über Nacht nur noch verpackte Ware im Tresen liegt. Abhilfe schafft hierbei eine geeignete Abdeckung, die bei neuen Geräten oft bereits integriert ist, aber auch bei älteren Geräten nachgerüstet werden kann.
Meist können die Rollos oder Folien mit einfachen Mitteln und in Eigenleistung angebracht werden.
Austausch älterer Kühlmöbel
Neue Kühlmöbel verbrauchen aufgrund ihrer höheren Energieeffizienzklasse deutlich weniger Strom, bei gleicher Kälteleistung. Bei Kühlregalen sollten anstatt offener, solche mit Glastüren angeschafft werden.
Wie beim Verflüssiger, verringert sich auch bei den Kühlmöbeln (Kühl- und Gefrierschränke-oder Truhen, Getränkekühlschränken) der erforderliche Energiebedarf, je niedriger die Umgebungstemperatur ist. Beim Verflüssiger bewirkt eine um ein Grad geringere Umgebungstemperatur einen um 4% verminderten Energieverbrauch.
Folgende Aufstellorte sollten gemieden werden:
- Orte direkter Sonneneinstrahlung
- neben Heizkörpern
- neben Herden
- an Warmluftauslässen
Auslastung und Bestückung
Bei nur teilweise bestückten Kühlmöbeln sollte geprüft werden, ob die Waren nicht in einem Kühlmöbel zusammengefasst werden können. Die dann nicht mehr benötigten Kühlmöbel können abgeschaltet werden. Achtung: Nicht über die Stapelmarke beladen, da es sonst zu einer Störung des Kühlluftschleiers kommt (Luftkanäle freihalten).
Beleuchtung
Wärme, die durch die Beleuchtung erzeugt wird, muss wieder von den Kühlaggregaten herunter gekühlt werden. Es sollten also Lampen mit einer geringeren Wärmeentwicklung (z.B. LED) eingesetzt werden, oder ihre Anzahl (Ausbau/Abschaltung) auf das erforderliche Maß reduziert werden, soweit es die
Arbeitsstättenrichtlinie "Beleuchtung"
und andere Sicherheitsvorschriften zulassen. Beim Austausch von Lampen oder Neuinstallation ist auch auf Qualitätsmerkmale wie Farbwiedergabeindex, erforderliche Schutzklasse etc. zu achten.Tiefkühlware auftauen
Tief gefrorene Lebensmittel sollte man (wenn möglich) im Kühlmöbel auftauen, hierbei wirkt das Gefriergut als Kühlquelle und das Kühlmöbel verbraucht dadurch weniger Energie.
Abdeckung von Kühlmöbeln
In der Filiale aufgestellte offene Kühlmöbel laufen häufig 5-Tage pro Woche durchgängig. Sie verbrauchen also auch Energie und verschleißen dementsprechend, auch wenn über Nacht nur noch verpackte Ware im Tresen liegt. Abhilfe schafft hierbei eine geeignete Abdeckung, die bei neuen Geräten oft bereits integriert ist, aber auch bei älteren Geräten nachgerüstet werden kann.
Meist können die Rollos oder Folien mit einfachen Mitteln und in Eigenleistung angebracht werden.
Austausch älterer Kühlmöbel
Neue Kühlmöbel verbrauchen aufgrund ihrer höheren Energieeffizienzklasse deutlich weniger Strom, bei gleicher Kälteleistung. Bei Kühlregalen sollten anstatt offener, solche mit Glastüren angeschafft werden.

|
| Einsparungen bei Kühlmöbeln |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |
Kühlanlage / Kühlaggregat
Standort des Verflüssigers
Im Verflüssiger kondensiert das Kältemittel wieder. Die Energieeffizienz ist am größten, je niedriger die Umgebungstemperatur ist. Jedes Grad weniger an Umgebungstemperatur vermindert den Energieverbrauch / Energiekosten. Durch Aufstellung des Verflüssigers im Außenbereich (schattig und ausreichend belüftet) lassen sich weitere Energieeinsparungen erzielen.
Ist die Möglichkeit nicht gegeben, den Verflüssiger im Außenbereich zu installieren, sollte darauf geachtet werden, die einzelnen Aggregate richtig anzuordnen. Bei der Belüftung des Maschinenraumes, sollte darauf geachtet werden, dass immer ausreichend kühle Luft angesaugt werden kann (Vermeidung von Wärmestau). Beachtet werden sollte auch hier, dass keine Luftzirkulation entstehen kann, ggf. Abluftanlage vorsehen.
Typische energetische Schwachstellen der Kühlanlage / Kühlaggregat
Maßnahmen
Im Verflüssiger kondensiert das Kältemittel wieder. Die Energieeffizienz ist am größten, je niedriger die Umgebungstemperatur ist. Jedes Grad weniger an Umgebungstemperatur vermindert den Energieverbrauch / Energiekosten. Durch Aufstellung des Verflüssigers im Außenbereich (schattig und ausreichend belüftet) lassen sich weitere Energieeinsparungen erzielen.
Ist die Möglichkeit nicht gegeben, den Verflüssiger im Außenbereich zu installieren, sollte darauf geachtet werden, die einzelnen Aggregate richtig anzuordnen. Bei der Belüftung des Maschinenraumes, sollte darauf geachtet werden, dass immer ausreichend kühle Luft angesaugt werden kann (Vermeidung von Wärmestau). Beachtet werden sollte auch hier, dass keine Luftzirkulation entstehen kann, ggf. Abluftanlage vorsehen.
Typische energetische Schwachstellen der Kühlanlage / Kühlaggregat
- Zu hohe Temperaturdifferenz zwischen Verdampfer und Verflüssiger ⇒ dadurch ist auch die Druckdifferenz größer, welche vom Verflüssiger überwunden werden muss
- mangelnde Dämmung der Kälteleitungen
- keine Abwärmenutzung (Wärmerückgewinnung)
- Standort des Verflüssigers
- kein Ölabscheider (Seite 75)
Der beste Standort für einen Verflüssiger ist der Außenbereich eines Gebäudes. Außerdem sollte das Aggregat schattig aufgestellt und etwas großzügiger dimensioniert werden. Bei mehreren Verflüssigern: Darauf achten, dass die Abwärme des einen Aggregats nicht von einem benachbarten angesaugt werden kann („Warmluftkurzschluss“). Leistungsgeregelte Abluftanlagen installieren wenn sich Kälteaggregat in einem Raum befindet.
Maßnahmen
- bei zu hoher Temperaturdifferenz
- Anhebung der Temperatur am Verdampfer durch größere Tauscherflächen
- Kältebedarf überprüfen (evtl. Anhebung der Temp.)
- Leitungen dämmen
- Abwärme zur „Vorheizung“ von Prozesswasser oder zur Heizungsunterstützung nutzen
- VORSICHT bei Brennwertkesseln: eine Anhebung der Rücklauftemperatur vermeiden
- Einsatz von elektronischen Expansionsventilen
- Zylinderabschaltung (ab 4-Zylindern)
- Effiziente EC-Motoren z.B. bei den Ventilatoren (EU-Effizienzklassen beachten)

|
| Kühlaggregat |
| Copyright: Handwerkskammer für Ostthüringen |
Tools für Erfassung, Berechnung und Bewertung
Die folgenden Berechnungstools sind vor allem an Fachbetriebe für Kältetechnik gerichtet:
- Kältebedarfsberechnung
- Abschätzung des Elektrizitätsbedarfs der Kälteanlage
- Kältemittel-Portal Umweltbundesamt
Messgeräte
- Thermografiekamera
- Ultraschallgerät zur Leckageortung
- Videoendoskop
- Fotoapparat
- Taschenlampe
weiterführende Informationen / Links
Linkliste: (Stand 2015)
Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik Maintal
Informationen zur F-Gas Verordnung:
Fachzeitschriften:
Fördermöglichkeiten:
weitere:
Landesinnung Kälte-Klima-Technik Hessen-Thüringen/Baden-Württemberg
Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik Maintal
- Einlegeblatt für Betriebshandbücher
- Kurzinformation zur Betriebssicherheitsverordnung und Arbeitsschutzgesetz - Pflichten des Betreibers
- Kältemittelgrenzen / GWP-Werte
Hauptsache KALT?
Was müssen Betreiber von Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln ab 2015 beachten?Informationen zur F-Gas Verordnung:
VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006
Fachzeitschriften:
KK - Die Kälte & Klimatechnik (Gentner Verlag)
KI - Luft- und Kältetechnik (C. F. Müller Verlag, Heidelberg)
KKA - Kälte Klima Aktuell
Fördermöglichkeiten:
Online Förderechner
Antrag für Förderung von Kälte- und Klimaanlagen
Förderung von Kälte- und Klimaanlagen
weitere:
Treffpunkt Kälte
Das wichtigste aus Kälte und Klima
ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. "Gaswärmepumpe/Kälte"
Norddeutsche Kältefachschule